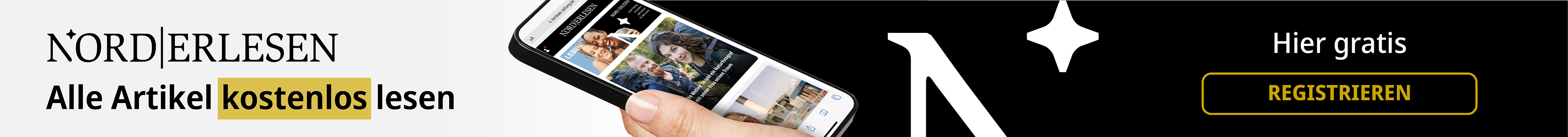„Komm, Kind, wir wollen Enten füttern gehen!“ Viele werden diesen Satz so oder so ähnlich von den eigenen Eltern oder Großeltern gehört haben. Schnell noch altes Brot eingepackt und ab an die nächste Wasserstelle. Entenscharen, mancherorts auch wenig scheue Gänse und Schwäne, rasen auf die knisternde Tüte zu: Das muntere Füttern kann beginnen. Doch nur die wenigsten Menschen wissen, dass sie damit weder den Tieren noch dem See, oder wie in diesem Fall dem Burggraben, etwas Gutes tun. „Brot enthält zu viele Kohlenhydrate. Das können Vögel nicht verdauen. Außerdem enthält es Salz und zu viel Fett. Die Vögel verfetten und schauen sich selbst nicht mehr nach Nahrung um“, sagt Bernd Quellmalz. Schlimmer noch sei, dass das trockene Brot im Magen aufquillt und dem Körper Flüssigkeit entziehe. Mit vollen Mägen würden die Wasservögel daraufhin nicht ausreichend trinken. Dennoch erfreut sich der „Freizeitsport Entenfüttern“ großer Beliebtheit.
PASSEND ZUM ARTIKEL

Von Dirk Bliedtner25.10.2025

Geestland
Gastronomie
Gastronomischer Leerstand in der Burg hält an
Von Julia Dührkop25.10.2025
Von Julia Dührkop25.10.2025